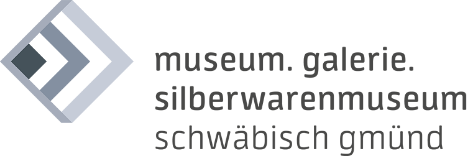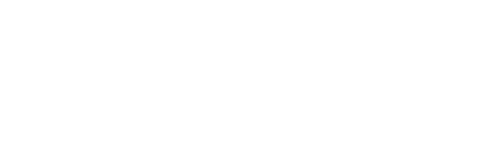»Es ist meine innerste Überzeugung«, schreibt Hermann Bauer 1874, »daß die Errichtung einer Vorbildersammlung nach dem Beispiel des Kensington-Museums gewiß für den hiesigen Platz von Vorteil wäre, und daß bei richtiger Pflege des guten Geschmacks seinerzeit Gmünd eine hervorragende Stelle in der deutschen Gesamtindustrie sich erwerben und erhalten wird.« Mit dem Verweis auf das später in Victoria and Albert Museum umbenannte South Kensington Museum legte Hermann Bauer das Grundkonzept des Gmünder Museums fest.
Die britische »Mutter« aller Kunstgewerbemuseen trifft den Nerv der Zeit und fand zahlreiche Nachahmer. In Deutschland macht das Kunstgewerbemuseum in Berlin 1867 den Anfang, gefolgt 1869 von dem Bayerischen Gewerbemuseum in Nürnberg (seit 1987 an das Germanische Nationalmuseum angegliedert). 1872 bis 1874 gesellen sich dazu die Kunstgewerbemuseen in Leipzig und Hamburg, auf die das Gmünder Museum bereits 1876 als erstes seiner Art im heutigen Baden-Württemberg folgt.
Ganz so wie das 1852 in London eröffnete Museum sollte das Gmünder Institut durch eine Vorbildersammlung zu einer künstlerischen Hebung der heimatlichen Kunstindustrie, namentlich des Edelmetallgewerbes, führen. In Gmünd formulierte das Gründungskomitee den Sammlungsauftrag des neuen Instituts. Es ging um den Erwerb mustergültiger Vorbilder und das Sammeln von metall- und stilgeschichtlichen Trendstücken.
Eine weitere wichtige Weichenstellung für die heutige Museumssammlung brachte das Jahr 1890: Kommerzienrat Julius Erhard schenkte an seinem 70. Geburtstag seine Sammlung Gmünder Altertümer der Vaterstadt. Wie der Schenkungsurkunde zu entnehmen ist, war sie unter dem Leitgedanken entstanden, »die geschichtliche, bauliche, wirtschaftliche und industrielle Vergangenheit der Stadt Gmünd zur Veranschaulichung zu bringen.«
Erhards in fast fünf Jahrzehnten zusammengetragene Sammlung enthielt schon damals mehr als tausend Gegenstände, darunter zahlreiche Skulpturen, Malereien, Silbergerät und Schmuck aus dem regionalen und internationalen Umfeld.
Im Jahr 1900 kam, ebenfalls als Schenkung, nun der Söhne Erhards, die mehr als 1.000 Blätter umfassende Bilderchronik hinzu; sie ergänzt den grafischen Bestand der Sammlung mit mittelalterlichen Büchern und Holzschnitten (u. a. von Hans Baldung Grien), Plänen und Zeichnungen des 18. Jahrhunderts, Aquarellen und Stichen des 19. Jahrhunderts sowie frühen Fotografien.
Mit der von Julius Erhard überlassenen Sammlung Gmünder Altertümer in Verbidung mit dem Bestand des Gewerbemuseums und der Bilderchronik waren bereits um das Jahr 1900 die wichtigsten Sammlungsschwerpunkte für das Museum fixiert. Über Jahre hinweg erweiterten Ankäufe, Schenkungen und Künstlernachlässe den Sammlungsbestand quantitativ wie qualitativ.
Das Museum verfügt damit über umfangreiche Bestände aus dem kunstgewerblichen, kunsthistorischen und stadtgeschichtlichen Bereich. Somit bewahrt es wesentliche Teile des kulturellen Erbes nicht nur der Stadt, sondern auch der Region und weit darüber hinaus von den Anfängen bis zur Gegenwart, was es zu einer der bedeutendsten Einrichtungen in der baden-württembergischen Museumslandschaft macht.